Freitag, 25. Juni 2010
Gemütszustände googlen
rrrock, 04:35h
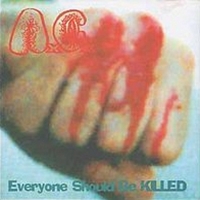
Anal Cunt
Everyone Should Be Killed
Earache Records (1994)
Es soll Menschen geben, die sich langweilige Stunden zuweilen damit vertreiben, indem sie ihren momentanen Gemütszustand als Suchbegriff bei Google eingeben. Ein Zeichen sozialer Vereinsamung? Vielleicht. Dennoch allemal besser, als dergleichen in sogenannten 'Netzwerken' wie Facebook zu praktizieren, wo damit dann sogenannten 'Freunden' mit Statements wie "Ich weiss nicht mehr weiter" oder "Ach, ist das alles schrecklich" oder, noch schlimmer, "Freu!" auf die Nerven gegangen wird. Aber auch das scheint im Zeitalter zunehmender sozialer Vereinsamung weitestgehend akzeptiert, auch wenn Zeitgenossen mit Stil, Würde, Bildung und Anstand dergleichen natürlich niemals tun würden.
Richtig problematisch würde die Sache allerdings dann werden, wenn dabei der Titel einer der seltsamsten und eigenwilligsten (viele würden vermutlich sagen: schlechtesten, andere, weitaus weniger zahlreiche, würden sagen: besten) CDs aller Zeiten als Ausdruck der momentanen Gemütsverfassung gewählt werden würde. 'Everyone should be killed' ist ein wohltuend eindeutiges, zugleich sicherlich auch etwas misanthropes Statement, welches Titel des ersten 'richtigen' Studioalbums der us-amerikanischen Hard- oder Noisecore Band Anal Cunt ist (Earache Records, 1994), eine CD, die 1995 oder 1996, so genau weiss ich das nicht mehr, auf verschlungenen, gleichwohl glücklichen Wegen in meine Discothek gelangte.

'Everyone should be killed' enthält auf 58 Minuten Spielzeit sagenhafte 58 Titel, die so klangvolle Namen tragen wie 'Some Songs', 'Some More Songs', 'Even More Songs', 'Music Sucks', 'Shut Up Mike' oder 'Our Band Is Wicked Sick (We Have the Flu)' tragen. Mein persönlicher Favoriten ist das kritisch-selbstreflexive '"I'm Not Allowed to Like A.C. Any More Since They Signed to Earache"'. Die Musik besteht aus Lärm und Geschrei, ist grauenhaft aufgenommen und am Stück eigentlich nicht konsumierbar. Aber in ihrer Konsequenz und ihrem bockigen Nihilismus ist diese CD schlicht grandios. Sie ist ein todsicheres Mittel um unliebsamen Besuch loszuwerden (falls sie dabei wider erwarten einmal doch versagen sollte, hilft immer noch der Griff nach 'Locust Abortion Technician' von den Butthole Surfers, die ich hier bei Gelegenheit auch einmal vorstellen werde). Sie hilft in ihrer Sturheit über trübe Stunden hinweg und ist in ihrer schäbigen Aufmachung eine Zierde jeder CD-Sammlung. Man muss sie streng genommen nicht einmal hören, haben reicht völlig. Und sicher ist: Würde vorne auf der CD 'John Zorn' stehen, das Feuilleton würde sich überschlagen vor Lob.
Mehr gibt es über dieses epochale Meisterwerk nicht zu sagen. Darum: Kaufen, lachen und den Besuch schockieren.
... link
Montag, 12. Oktober 2009
Aus dem Ring - in den Ring
rrrock, 02:47h

The Wrestler
USA 2008
R: Darren Aronofsky
105 Min.
Selten wurde das Comeback eines Schauspielers so bestaunt und - zu Recht - gefeiert, wie das von Mickey Rourke in Darren Aronofskys grandiosen The Wrestler. Dass diese Rolle wie für ihn geschaffen scheint, weil es so viele offensichtliche Parallelen zwischen dem Scheitern des Protagonisten und dem Niedergang des Darstellers in den Neunziger Jahren gibt, ist dabei allerdings nur eine Nebensächlichkeit. Denn was The Wrestler seine ungeheure Wucht und Glaubwürdigkeit verleiht, ist weniger der Realismus, mit dem auch die tiefsten Niederungen des Wrestling dargestellt werden (wer nicht glaubt, dass es so viel Blut im Ring wirklich gibt, sollte mal nach 'Combat Zone Wrestling' googlen...), es ist auch nicht allein die Tragik, mit der Leiden, Triumph und Scheitern dramaturgisch meisterhaft in Szene gesetzt werden - auch wenn einem beides mit äußerster Schonungslosigkeit um die Ohren gehauen wird. Nein, was The Wrestler so gelungen macht, das ist fast allein die schauspielerische Leistung Mickey Rourkes, die ihm in dieser Güte wohl kaum jemand (mehr) zugetraut hat.
Man denkt zu keinem Zeitpunkt: "Mickey Rourke spielt einen Wrestler". Man denkt auch nicht "Mickey Rourke spielt einen Wrestler" und man verbaut sich viel, wenn man das Schicksal Rourkes ständig im Hinterkopf behält, während man teilhat am tragischen Schicksal Randy 'The Ram' Robinsons, einem Wrestler, der nach gefeierten Triumphen in den Achtzigern noch einmal in den Ring zurückkehrt, nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil er nichts anderes wirklich kann und in der Welt außerhalb des Rings nicht zurechtkommt. Und weil er das Geld, dass es dafür nicht gerade üppig gibt, dringend braucht. Nein, Rourke spielt, aber was ausbleibt, ist das Gefühl, dass gespielt wird - im Sinne Roland Barthes' fehlt der 'Stumpfe Sinn', der die Darstellung als Darstellung entlarvt - was nicht heißen soll, The Wrestler trüge Züge eines Doku-Dramas, denn das ist zu keinem Zeitpunkt der Fall. Aber man nimmt Rourke die Rückenschmerzen ab, man sieht die Folgen jahrelangen Anabolika-Mißbrauchs, zu viel Alkohols und unendlicher Enttäuschungen in Gesicht und Leib des Protagonisten als echte, authentische Erscheinungen. Und man nimmt sie für voll, nicht nur als Chiffre, die für etwas dahinterliegendes steht, sondern erlebt und erleidet sie mit. Dass das gelingt, ist einer schauspielerischen Leistung geschuldet, die man nicht genug würdigen kann. Denn obwohl Rourkes Mimik durch Botox, Alkohol und wer-weiß-was-noch-alles erheblich eingeschränkt ist, gelingt es ihm, allein schon mit leisesten mimischen und gestischen Andeutungen einen tiefen Blick in das fragile Innere des alternden Ringers zu ermöglichen und die Würde und Authentizität, mit der er dabei agiert, ist schlicht überwältigend.
Man möchte sich wünschen, dass Rourkes' Rückkehr in den Ring anders ausgeht, als für Randy 'The Ram' Robinson. Und um so mehr, dass auch das Leben außerhalb des Lebens weniger Verletzungen für ihn bereit hält, als es in den vergangenen Jahren wohl der Fall gewesen ist. Denn dann stünde zu hoffen, dass es mehr gibt, als dieses grandiose Comeback.
... link
Sonntag, 27. September 2009
Die Angst vor der Selbstauflösung
rrrock, 18:47h

Antichrist
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien, Polen 2009
R: Lars von Trier
104 Min.
Das Gezeter war absehbar und vermutlich auch vom Regisseur intendiert. Es ist eine traurige Folge der kulturindustriellen Vermarktung, dass die wenigen sehr guten und ausgezeichneten Filme, die nicht den Konventionen des kommerziellen Mainstream-Kinos folgen, mit drastischen Bildern schockieren müssen, weil sie sonst vom Gros des Publikums gar nicht erst wahrgenommen werden. Das war bei Gaspar Noés großartigem Irreversible so und das ist auch bei Lars von Triers nicht minder großartigen Antichrist der Fall. Dabei bräuchte von Trier diese (wenigen) Schockbilder - ich fasse kurz zusammen: Genitalverstümmelung, Beinverletzung, abgestorbene Tierföten - überhaupt nicht; Antichrist wäre auch ohne Blut ein phantastischer Film.
Dass das so ist, ist vor allem der schauspielerischen Leistung der beiden Darsteller - Charlotte Gainsbourg und Willem Dafoe - geschuldet. Mit einer unwahrscheinlichen Intensität und dem Mut zur Selbstentblößung (und damit ist nicht allein Nacktheit gemeint) spielen sie ein Paar, welches den Verlust des gemeinsamen Kindes in einer abgeschiedenen Waldhütte in Selbsttherapie aufzuarbeiten sucht. Sie ist hochgradig depressiv und psychotisch, er ist Psychotherapeut - dass das nicht gutgehen kann, ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, die auch im Wald allgegenwärtig ist. Der Wald als Gegenmetapher zur Sicherheit der Zivilisation, als Ort der Ängste und des Unbewussten, das ist allerdings nicht nur Teil einer erzkatholischen Ikonographie (wie die Protagonistin selber anmerkt: Die Natur ist Satans Kirche), sondern ein Element, welches sich wie ein roter Faden durch die abendländische Literatur des 20. Jahrhunderts zieht (Homo Faber, Masse und Macht etc.). Ebenso abendländisch ist die spezifisch männliche Angst vor der weiblichen Sexualität, die von Trier in allerdings drastische Bilder zu fassen vermag.
Dass diese Mélange aus Katholizismus und tiefenpsychologischen Clichés zu keinem Zeitpunkt auch nur annährend lästig wird, hängt damit zusammen, dass die Ängste, die von Trier inszeniert und zelebriert, Ängste sind, die eng mit der menschlichen Existenz an sich zusammenhängen: Angst vor Selbstverlust, Angst vor Selbstauflösung, Angst vor Verletzung und immer wieder Schuld, Schuld, Schuld. Diese sind zuvorderst Grundkonstanten der conditio humana und nicht an eine spezifisch religiöse Sichtweise gebunden. Aus diesem Grund wirkt Antichrist so heftig, und ich wage zu behaupten: bei jedem, der den Mut mitbringt, sich auf ihn einzulassen.
Was weitaus schwerer in Worte zu fassen ist, das ist die unheimliche Schönheit der Bilder, die Lars von Trier inszeniert und die den Betrachter viel unmittelbarer und nachhaltiger treffen, als die wenigen Schockszenen, auf die man im Grunde ja auch vorbereitet ist. Natürlich muss sich von Trier angesichts dieser Bilder fragen lassen, ob er Frauen hasst (ja, tut er) ob er Angst vor der Hölle hat (hat er bestimmt) und ob es ihm in den letzten Jahren möglicherweise alles andere als gut ging (ging es ihm nicht). Und natürlich ist eine solche Form der Selbsttherapie - von Trier litt an einer schweren Depression - fragwürdig und nicht alles, was von Trier dem Zuschauer zeigt, will dieser auch wirklich sehen respektive wissen.
Aber wenn man sehen will, wie Kino sein kann, wenn sich jemand der Sache annimmt, der es richtig kann, dann sollte man sich Antichrist nicht entgehen lassen.
... link
Donnerstag, 25. Juni 2009
Blood, Tea & Red String
rrrock, 03:58h

Blood, Tea & Red String
USA 2006
R: Christiane Cegavske
70 Min., Cinema Epoche
Es gibt Filme, die man sofort ins Herz schließt. Nicht so sehr, weil sie besonders liebenswerte oder anrührende Geschichten erzählen, sondern weil man ihnen die ganze Mühe und das ganze Herzblut ansieht, die ihr Erschaffer ihnen gewidmet hat. Eraserhead (David Lynch, USA 1977) ist so einer, sowie Wenzel Storchs Sommer der Liebe (D 1992) und natürlich dessen opus magnum Die Reise ins Glück (D 2005). In gewisser Hinsicht gehören auch die Arbeiten des frühen Peter Jackson - insbesondere Meet the Feebles (NZL 1989) - in diese Reihe, auch wenn Jackson bekanntermaßen bereits ab seinem zweiten Spielfilm auf ein vergleichsweise komfortables Budget zurückgreifen konnte.
All diesen Filmen ist gemein, dass sie unter widrigsten Umständen und mit minimalstem Budget entstanden sind und in jeder Filmminute augenscheinlich wird, dass es einzig und allein der Beharrlichkeit ihrer Erschaffer zu verdanken ist, dass diese Kleinode der Filmgeschichte überhaupt zu Ende gebracht werden konnten. Filme, die gemacht werden müssen, ganz gleich, ob sie einen sogenannten 'Markt' haben, sich 'rechnen' oder 'floppen'. Diese Kategorien zählen bei dieser Sorte Film nicht, sie sind angesichts der wahren und erhabenen Größe solcher Filme als Kriterien geradezu lächerlich. Kino, das man nicht in Geld umrechnen kann - obgleich man es seinen Erschaffern so sehr wünschen würde, dass ihre Filme ihnen wenigstens ein komfortables Überleben sichern. Bei David Lynch hat das ja schon mal einigermaßen geklappt, von Peter Jackson wollen wir lieber gar nicht erst reden. Er ist zumindest der schlagende Beweis dafür, wie ungünstig sich ein wachsendes Budget auf die Qualität des Endproduktes auswirken kann...
Dieser mein persönlicher Olymp des Liebhaber-Cinemas hat Zuwachs bekommen. Und ginge es allein um die Zahl der Jahre, die ein Künstler in sein Kunstwerk investiert, dieser Film würde ohne Umschweife auf Platz eins stehen, denn Christiane Cegavske hat sage und schreibe dreizehn (!) Jahre ihres Lebens investiert, um uns ein 70 Minuten dauerndes Traumgebilde in Stop-Motion Technik zu kredenzen, dass sie samt und sonders allein erdacht, gebastelt, genäht, gemalt, gedreht und geschnitten hat. Abgesehen von der feinen und sehr fragil wirkende Filmusik alles allein. Dreizehn Jahre lang. In Stop-Motion. Wie sehr muss man (s)einen Film lieben, um das durchzustehen? Eine schier unglaubliche Leistung.
Blood, Tea & Red String erzählt die seltsame Geschichte einer Familie eigenartiger Schnabelwesen mit Fell und Schweineohren, die unter einem Baum leben und sich durch eine Art liebenswürdiges Krähen verständigen (im ganzen Film wird kein einziges Wort gesprochen). Eines Tages werden sie von rotäugigen Ratten oder Mäusen mit aristokratischem Gebahren zum Bau einer menschenähnlichen Puppe angehalten, die sie nach Fertigstellung aber nicht herausrücken möchten, auch dann nicht, als die Ratten den vereinbarten Preis erheblich erhöhen. Den Ratten aber ist an dieser Puppe derart gelegen, dass sie selbige bald darauf entführen. Aber auch den eigenartigen Schnabelwesen ist diese Puppe sehr ans Herz gewachsen, so sehr, dass sie sich unverzüglich mit einer Delegation aufmachen, die Puppe aus den Händen der Ratten zu befreien. Was dann folgt, ist eine merkwürdig symbolstarke, teilweise leicht psychedelische und immer höchst eigenartig anmutende Reise durch ein seltsames Land, an deren Ende etwas steht, von dem ich gar nicht so genau weiß, ob es ein Happy-End ist; jedenfalls sehen die Schnabelwesen, die man sofort lieb hat, dabei nicht wirklich unglücklich aus.
Der Film ist dabei voller Symbole, die man nicht ohne weiteres entschlüsseln kann, aber, glaube ich, auch gar nicht entschlüsseln muss. Es genügt schon, einfach nur zu staunen über die eigenartige Welt, die sich da vor einem auftut. Darin ähnelt Blood, Tea & Red String äußerst stark den Filmen des großen David Lynch und an manchen Stellen wird Lynch auch ganz konkret zitiert. Was bei Lynch aber leicht Angst macht, löst hier bestenfalls ein leichtes Befremden aus, schlechte Träume macht dieser Film bestimmt nicht. Neben Lynch fühlte ich mich, vor allem wegen des Puppenmotivs, auch an den Sandmann E.T.A. Hoffmanns erinnert; auch dieser Vergleich wird an manchen Stellen geradezu zwingend - allerdings fehlt Bood, Tea & Red String jegliche Düsternis. Ein leichter bzw. leichtverdaulicher Film ist er dennoch nicht, gerade die üppig verwendete Metaphorik des Belebten im Unbelebten, der Verpuppung und (Wieder-)Geburt ist einigermaßen verstörend, zumal der Film keine Interpretationen und keine Erläuterungen anbietet und den Betrachter - höchstabsichtlich und in jeder Hinsicht - im Unklaren lässt.
Was soll ich sagen. Im Grunde fehlen mir die Worte. Kaufen, ansehen, auf die Knie sinken. Ein extrem seltsamer, extrem guter, extrem schöner, extrem liebenswerter Film. Leider ist er äußerst schwer zu bekommen aber das ist mit außergewöhnlichen Filmen nun einmal so.
... link
Dienstag, 23. Juni 2009
Es muss im Leben mehr als alles geben
rrrock, 02:52h

Vierzig Jahre Higgelti Piggelti Pop! in deutscher Sprache
Es gibt Kinderbücher, es gibt Bücher für Kinder, es gibt Kinderbücher für Erwachsene und es gibt Bücher für Kinder, die auch für Erwachsene geschrieben wurden (damit letztere beim Vorlesen nicht ganz so schnell einschlafen). Und es gibt Higgelti Piggelti Pop! oder Es muss im Leben mehr als alles geben, das opus magnum Maurice Sendaks, das vielleicht schönste Buch für Kinder und Erwachsene, das es überhaupt gibt.
Damit hätte die Geschichte durchaus das Zeug für ein moralinsaures pädagogisches Lehrstück, wäre da nicht der unglaubliche Humor Sendaks, der seine Protagonisten und ihre Existenz (die zugleich unsere Existenz ist) mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit im Skurrilen und Surrealen verankert, die in der amerikanischen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dieser Vehemenz eigentlich nur noch bei Thomas Pynchon zu finden ist. Und wahrscheinlich ist gerade dies der Schlüssel dazu, warum dieses Buch über alle Altersgrenzen hinaus so begeistert: Kinder wundern sich nicht über ein Schloß Anderswo, von dem keiner der Beteiligten weiss, wo es überhaupt genau liegt (nur der Löwe kennt den Weg); sie staunen vielmehr darüber. Erwachsene hingegen staunen darüber, dass sie sich nicht wundern. Kinder spüren einen leichten Grusel angesichts des großen weißen Hauses am Rande der Stadt; Erwachsene auch, nicht, weil sie das weiße Haus als psychiatrische Klinik deuten (was in jedem anderen Kontext nahe läge), sondern weil sie sich auf eine traumartige Weise daran erinnern werden, wie es war, als einem beim Gedanken bei weißen Häusern an Stadträndern noch ein leichter Schauder durchfuhr.
Durch gerade diese Traumartigkeit ist dieses Buch auf eine geradezu unheimliche Weise unmittelbar und bedarf eigentlich keiner Deutungen und Interpretationen, um verstanden zu werden - obgleich gerade die Traumnähe zu tiefenpsychologischen Deutungen einladen würde. Unweigerlich würden diese aber diesen kleinen, in sich schlüssigen Kosmos zerstören, der keine Weisheiten parat hält, sondern zum Staunen und Lachen einlädt. Insofern liest sich Higgelti Piggelti Pop! besser mit Kinderaugen - aber ganz gleich, wie man dieses Buch liest: Wer Jennie einmal kennengelernt hat, vergisst sie nicht wieder.
Vierzig Jahre ist es nun her, dass dieses großartigste aller Kinderbücher in deutscher Sprache erschienen ist. In amerikanischer Sprache erschien es bereits zwei Jahre zuvor, also 1967, unter dem Titel Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life und bereits die feine Doppeldeutigkeit des Titels zeigt, vor welche Herausforderungen sich Hildegard Krahé gestellt sah, die die großartige deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgt hat. Denn auch darin ist dieses Buch herausragend: Es wartet mit einer Übersetzung auf, die dem Original in Witz, Ironie und subtilem Sprachgebrauch in nichts nachsteht.
Völlig unerklärlich sind die Schwierigkeiten, vor die man sich in den letzten Jahren gestellt sah, wenn man Higgelti Piggelti Pop! käuflich erwerben wollte. Eine Schande für den Diogenes-Verlag, dass dieses Buch - zeitweise über Jahre - nicht erhältlich war, auch momentan ist das Buch beim Verlag leider nur vorbestellbar oder antiquarisch erhältlich.
Es gibt Kinderbücher, es gibt Bücher für Kinder, es gibt Kinderbücher für Erwachsene und es gibt Bücher für Kinder, die auch für Erwachsene geschrieben wurden (damit letztere beim Vorlesen nicht ganz so schnell einschlafen). Und es gibt Higgelti Piggelti Pop! oder Es muss im Leben mehr als alles geben, das opus magnum Maurice Sendaks, das vielleicht schönste Buch für Kinder und Erwachsene, das es überhaupt gibt.
"Einst hatte Jennie alles. Sie schlief auf einem runden Kissen im oberen und auf einem viereckigen Kissen im unteren Stockwerk. Sie hatte einen eigenen Kamm, eine Bürste, zwei verschiedene Pillenfläschchen, Augentropfen, Ohrentropfen, ein Thermometer und einen roten Wollpullover für kaltes Wetter. Sie hatte zwei Fenster zum Hinausschauen und zwei Schüsseln für ihr Futter. Und sie hatte einen Herrn, der sie liebte."Higgelti Piggelti Pop! handelt von Jennie, einem kleinen, britisch anmutenden Hund mit wuscheligem Fell, großem Appetit und einem höchst unzufriedenem Naturell. Jennie, die alles hat, und doch nicht glücklich ist, packt eines Tages alles, was sie besitzt, in eine große Ledertasche mit goldener Schnalle verlässt zu mitternächtlicher Stunde ihr trautes Heim. Ihre abenteuerliche Reise endet nach vielen Abenteuern (Zappelmagen! Löwenrachen!) und schicksalschweren Begegnungen mit Milchmännern, Stubenmädchen, schweinernen Talentscouts, Babies, die nicht essen wollen, Löwen, die Babies und Kindermädchen zum Fressen gern haben und fülligen Damen in Weiß schließlich auf Schloß Anderswo, als Hauptdarstellerin in Frau Hules Welttheater. Reich an Erfahrung ist sie nun und: ein Star. Das mutet surreal an, doch keine Sorge: In Jennies Welt wirkt das alles ganz normal. Und weil ein wenig Jennie scheinbar in jedem von uns steckt, wird man geradezu neidisch ob des Entwicklungsgangs, den die Protagonistin nimmt.
Damit hätte die Geschichte durchaus das Zeug für ein moralinsaures pädagogisches Lehrstück, wäre da nicht der unglaubliche Humor Sendaks, der seine Protagonisten und ihre Existenz (die zugleich unsere Existenz ist) mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit im Skurrilen und Surrealen verankert, die in der amerikanischen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dieser Vehemenz eigentlich nur noch bei Thomas Pynchon zu finden ist. Und wahrscheinlich ist gerade dies der Schlüssel dazu, warum dieses Buch über alle Altersgrenzen hinaus so begeistert: Kinder wundern sich nicht über ein Schloß Anderswo, von dem keiner der Beteiligten weiss, wo es überhaupt genau liegt (nur der Löwe kennt den Weg); sie staunen vielmehr darüber. Erwachsene hingegen staunen darüber, dass sie sich nicht wundern. Kinder spüren einen leichten Grusel angesichts des großen weißen Hauses am Rande der Stadt; Erwachsene auch, nicht, weil sie das weiße Haus als psychiatrische Klinik deuten (was in jedem anderen Kontext nahe läge), sondern weil sie sich auf eine traumartige Weise daran erinnern werden, wie es war, als einem beim Gedanken bei weißen Häusern an Stadträndern noch ein leichter Schauder durchfuhr.
Durch gerade diese Traumartigkeit ist dieses Buch auf eine geradezu unheimliche Weise unmittelbar und bedarf eigentlich keiner Deutungen und Interpretationen, um verstanden zu werden - obgleich gerade die Traumnähe zu tiefenpsychologischen Deutungen einladen würde. Unweigerlich würden diese aber diesen kleinen, in sich schlüssigen Kosmos zerstören, der keine Weisheiten parat hält, sondern zum Staunen und Lachen einlädt. Insofern liest sich Higgelti Piggelti Pop! besser mit Kinderaugen - aber ganz gleich, wie man dieses Buch liest: Wer Jennie einmal kennengelernt hat, vergisst sie nicht wieder.
Vierzig Jahre ist es nun her, dass dieses großartigste aller Kinderbücher in deutscher Sprache erschienen ist. In amerikanischer Sprache erschien es bereits zwei Jahre zuvor, also 1967, unter dem Titel Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life und bereits die feine Doppeldeutigkeit des Titels zeigt, vor welche Herausforderungen sich Hildegard Krahé gestellt sah, die die großartige deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen besorgt hat. Denn auch darin ist dieses Buch herausragend: Es wartet mit einer Übersetzung auf, die dem Original in Witz, Ironie und subtilem Sprachgebrauch in nichts nachsteht.
Völlig unerklärlich sind die Schwierigkeiten, vor die man sich in den letzten Jahren gestellt sah, wenn man Higgelti Piggelti Pop! käuflich erwerben wollte. Eine Schande für den Diogenes-Verlag, dass dieses Buch - zeitweise über Jahre - nicht erhältlich war, auch momentan ist das Buch beim Verlag leider nur vorbestellbar oder antiquarisch erhältlich.
... link